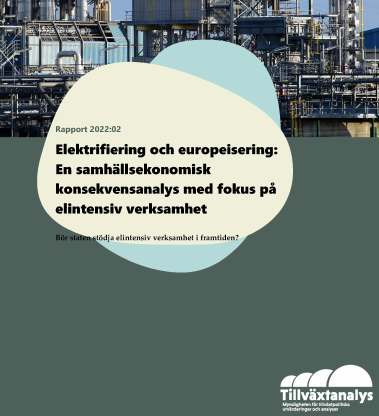
Neulich im Internet entdeckt (der Text kann frei heruntergeladen werden. Zusammenfassung bis S. 76):
" Rapport 2022:02 . Elektrifiering och europeisering: En samhällsekonomisk konsekvensanalys med fokus på elintensiv verksamhet", (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2022)
Betrachtet wird die Wechselwirkung Strommarkt, Europasierung und Ökonomie. In den Simulationen am Ende der Studie wird angenommen, daß im Jahr die Klimaumstellung in Schweden plangemäß durchgeführt wurde. Der historische Standortvorteil niedriger Strompreise ist durch den europäischen Stromverbund gefährdet.
In Erwartung steigender Strompreise prognostizieren die Autoren eine Verlagerung von Kapital, Arbei von der stromintensiven Industrie zu der expandierenden stromerzeugenden Industrie. Die Volatitilät der Strompreise wird zunehmen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung wird abnehmen.
Stromsubventionen exportorientierter Unternehmen sind fragwürdig. Die Subventionen führen oft zur Benachteiligung anderer Unternehmen. Das Beispiel der Rechenzentren der Internetkonzerne zeigt, daß politisch prestigevolle Projekte zu keinen adäquaten Steuereinnahmen führen.
Die Ausbreitungseffekte von gezielten (Steuer-)Subventionen, z.B. für Rechenzenter oder Batteriefabriken) werden oft überschätzt. Das Umfeld profitiert oft weniger als gedacht. Schweden untersützt wie andere Länder seine Industrie durch Stromsteuersubventionen.
Die Energiewende hat weniger mit finanziellen Fragen zu tun, sondern eher mit Entscheidungen über die Verwendung knapper Ressourcen. Preise geben Anhaltspunkte über die Ressourcenverfügbarkeit. Die Autoren weisen auf das Kaldor-Hicks-Kriterium hin (-> WIKI) für ökonomische Transformationen.
Der heutige Wohlstand Schwedens beruht historisch zu einem großen Teil auf seinen niedrigen Stromkosten, was durch gezielte staatliche Förderung entsprechender Industriebranchen verstärkt wurde. Die in Schweden vorhandene Industriestruktur ist ein Relikt dieser Vergangenheit.
In einem geschichtlichen Rückblick wird beschrieben, daß um 1900 die Elektrifiziering Schwedens fast ausschließlich Beleuchtungszwecken diente. Bis 1960 erreichte der Ausbau der Wasserkraft nahezu seinen Abschluß. Ab 1963 und in den 1980er Jahren wurde die Atomkraft ausgebaut, fast 50% Stromproduktion. Ab ca 2010 kam die Windkraft hinzu, begleitet von einem (politisch gewollten) Rückgang der Kernenergie.
Vor 2011 war Schweden wechselnd Stromimporteur und Stromexporteur. Danach fast durchgehend Nettostromexporte als Folge abnehmenden Stromverbrauchs der Industrie und einer gesteigerten Stromproduktion durch die Windkraft. Das System der el-Zertifikate hat das begünstigt.
Mit der Atomenergie stieg die Stromproduktion und der private Verbrauch nahm zu: 1980 entfielen auf die Industrie ca 50% des Stromverbrauchs. Wohnen & Service ca. 35%. Im Jahr 2019 war die Situation umgekehrt: 35% Industrie, 50% Wohnen & Services.
Systempreis bezieht sich auf den Preis ohne Transporthindernisse. In den 00er-Jahren entwickelten sich die Strompreise Haushalte / Idustrie auseinander. Von früher ca. pari zu einem Preisverhältnis von ca. 3:1 durch unterschiedliche Netzabgaben und Steuern.
Die Strombörse Nordpool umfaßt den skandinavischen Strommarkt, Schweden & Norwegen seit 1996, Finnland 1998, Dänemark 2000 . Der Stromhandel erfolgt nach dem Merit-of-Order-System. Maßgebend sind meist die operativen Kosten der Anbieter, nicht die Selbstkosten.
Die Netzanschlußmöglichkeiten hinken in Schweden dem Bevölkerungswachstum und der expandierenden Industrie hinterher. Wohnsiedlungen und Betriebe konnten deshalb oft nicht gebaut werden. Der Ausbau der Wasserkraft fraglich, weil Umweltschutzgesichtspunkte und EU-Regeln dem entgegenstehen.
In Fig_3.16, S. 46(Papier), S. 47(pdf) sind die EU-Industriestrompreise für stromintentensive Unternehmen im Jahr 2020 dargestellt. Deutschland hat mit über 140 Cent / KWh ca. doppelt so hohe Preise wie Schweden oder Frankreich. Die höchsten Strompreise finden sich in Dänemark, mehr als 220 Cent / KWh. Allerdings vermuten die Autoren, daß durch geheimgehaltene Stromsteuersubventionen die Preise EU-weit für die stromintensive Industrie ähnlich sind.
Grundstoffindustrie in Schweden: im Wesentlichen Stahl- und Eisen, Bergbau, Zellstoff / Papier / Pappe. Beschäftigtenanteil ca. 3.5% insgesamt, 22% der Industrie. Faktor 2.9 Jobs außerhalb. Direkte und indirekte Wertschöpfung der Grundstoffindustrie in Schweden 4.5% insgesamt, 23% Wertschöpfung der Industrie. Multiplikatorfaktor der Wertschöpfung 2.4, dh für jede Krone direkt werden zusätzlich 1.4 extra geschaffen. 90% davon in Export. Damit 20% der schwedischen Exporte. (2018)
Forstindustrie umfaßt Holzverarbeitung, Papier / Pappe / Zellulose, Waldwirtschaft. Gegenwärtig die am meisten stromintensive Industrie Schwedens. Beschäftigtenanteil ca. 2%. Multiplikatorfaktor Beschäftigten ca. 2.5 , vor allem durch die vielen Vorprodukte und Transportanforderungen in der massa-Industrie. Wertschöpfung ca. 2.5% gesamt an der schwedischen Wertschöpfung. Multifaktor Wertschöpfung ca. 2.5 . Exportanteil der Branche ca 85%, entsprechend 10% der schwedischen Exporte.
Stahl- und Metallindustrie: Beschäftigtenanteil ca. 1.5%, Multifaktor 2.9 . Die meisten indirekten Jobs jedoch im Bereich Recycling und Sanierung. Wertschöpfungsanteil insgesamt 1.3%, Multifaktor 2.7 . Exportanteil der Stahl- Eisenindustrie 96% , entsprechend 7% der gesamten schwedischen Exporte. Der Energieverbrauch der massa-Industrie beträgt 50 TWh, davon 2 TWh fossil, der Rest Holz, Rinde und Lauge. Die massa-Industrie liefert 35 TWh Biobrennstoffe aus Holz, Rinde, Restholz (GROT). Stromverbrauch massa-Industrie ca 2018 ca 11 TWh, Stahl- und Eisenindustrie ca 4 TWh, Chemieindustrie ca 3.5 ThWh.
Die Stromintensität, Wertschöpfung / Stromverbrauch, hat in Schweden abgenommen. Industrieweit zwischen 2004 - 2016 um ca 40 %, Stahlindustrie ca 52%. Stahlindustrie relativ unempfindlich gegen Strompreiserhöhungen, schlechte Substituierbarkeit Strom - Kapital & Arbeit. Chemieindustrie etwas stärker beeinflußt.
Zur Beschreibung der Belastungen durch Stromausfälle gibt es zwei Kriterien: VoLL, Value-of-Lost_load, Kosten für eine ausgefallene KWh. Wird oft verwendet, um Rangordnungen bei Lastabwürfen zu bestimmen. Und CpH, Cost-per-Hour, die Kosten für eine Stunde Stromausfall. CpH nimmt mit Betriebsgröße meist zu, anscheinend aber relativ konstant pro Angestellter. CpH liegt oft Investitionsentscheidungen zugrunde.
Mit der gesteigerten Energieeffizienz haben die VoLL-Werte der Industrie i.a. zugenommen. Die höchtsten VoLL-Werte haben die Elektronik- und die Maschinenindustrie. Stromintensive Industrien haben meist einen geringeren VoLL.
Mit der Klimaumstellung wächst der Stromverbrauch durch Substition fossiler Energien und durch neue Anwendungen. Die Autoren halten die neuen Anwendungen für derzeitig nicht rentabel, es gibt nicht genügend Daten über die Kosten.
Für die Simulation von Angebots- und Nachfrageszenarien verwenden die Autoren ein CGE-CERE-Modell. Der Strommarkt gehorcht einem "Kupferplatten"-Modell, d.h. die Elektronen bewegen sich quasi ungehindert durch die EU. Simuliert werden auch die Import- und Exportmärkte. Das 40%-Reduktionsziel für Schweden ist 2030 bereits erreicht, desgleichen die 25% für die EU, entsprechend Fit-for-55.
Die Autoren gehen davon aus, daß die USA und der Rest der Welt der europäischen Klimaumstellung hinterherhinken. Bedingt durch die Kostenbelastungen werden in der EU die ökonomischen Aktivitäten [Binnenachfrage?] abnehmen und die Exporte nach den USA und den Rest zunehmen.
Die Handelsbeziehungen werden in zwei Alternativen simuliert: SOE, kleine-offene-Ökonomie. Die Preise sind durch den internationalen Markt gesetzt und können nicht von Schweden beeinflußt werde. MRT, multi-regionaler-Handel. Kostenerhöhungen können auf Verkaufspreise übergewälzt werden. Für Schweden wird ein Nachfragerückgang im 1/10 %-Bereich prognostiziert. Im SOE ca doppelt so hoch wie im MRT. Für Deutschland führt die fossile Abhängigkeit zu Werten weit über EU-Durchschnitt.
Die Belastung der Industrie durch hohe Strompreise hängt davon ab, inwieweit die Kostensteigerungen auf die Preise übergewälzt werden können. Haushalte mit niedrigem Einkommen sind durch hohe Strompreise besonders betroffen. Jedoch wäre das in Schweden mit steigenden Stromexporten verbunden. Der damit entstandene Wohlfahrtsgewinn könnte zur Kompensation besonders betroffener Haushalte verwendet werden -> Kaldor-Hicks-Kriterium. Ein verlangsamter Ausbau der transnationalen Stromnetze würde einkommensschwachen Haushalte in Schweden zugute kommen.
Die Investitionen der Klimaumstellung werden zum großen Teil durch öffentliche Mittel finanziert. Es sollten deshalb der Öffentlichkeit auf eine transparente Weise Daten über die Rentabilität zur Verfügung gestellt werden. Auch sollte eine "second-opinion" institutionalisiert werden, um die betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Investitionen zu beleuchten.
#sverige #schweden #deutschland #tyskland # el #energiewende #klimatomställning