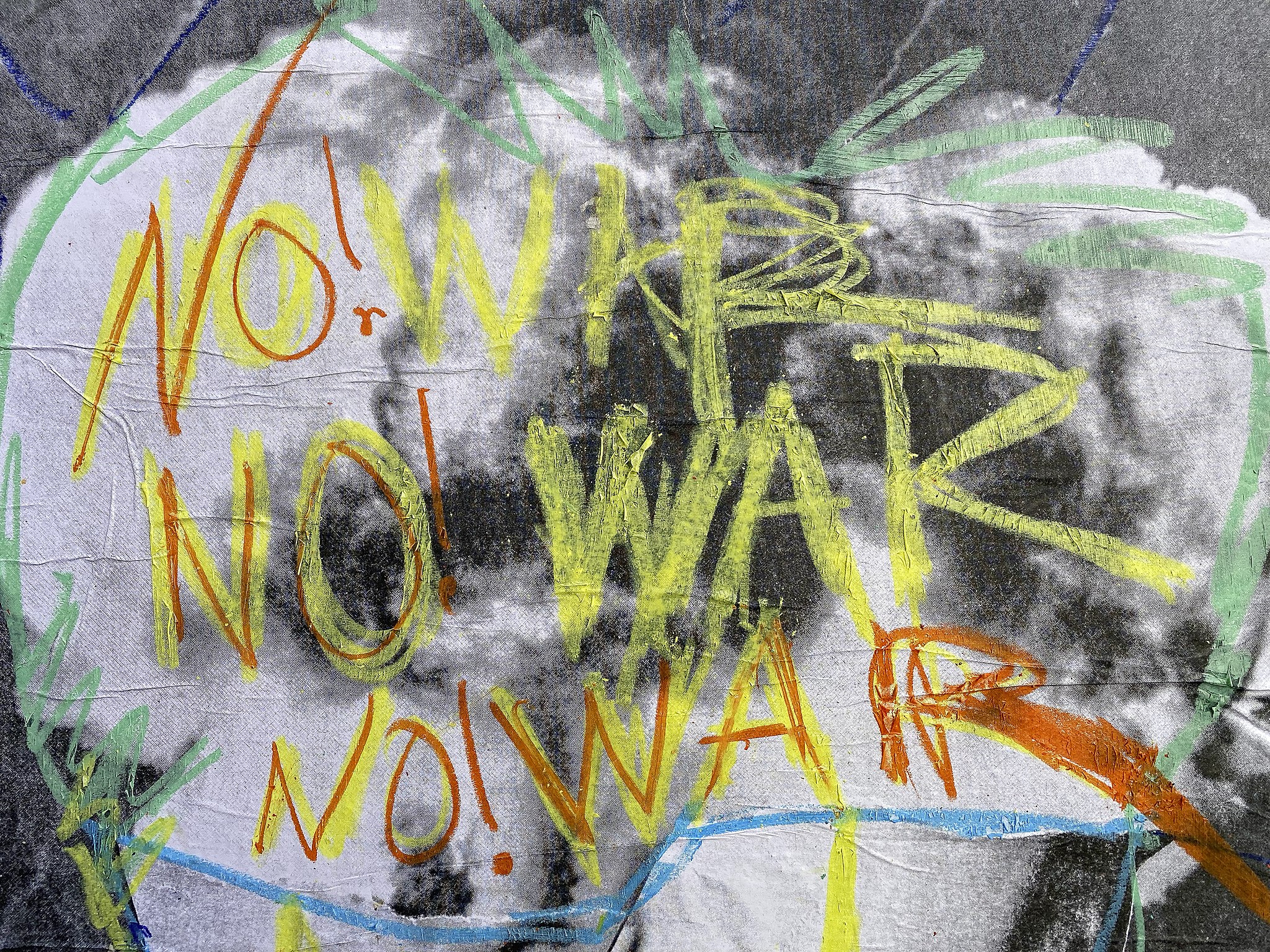#imperialismus
#politik #krieg #völkerrechtsbruch #zerstörung #ausplünderung #massenmord #irak #usa #uk #nato #deutschland #imperialismus
Einfach mal um einen Referenzrahmen zu schaffen eine Erinnerung was vor 20 Jahren im Irak geschah. Ohne jede Anklage und ohne jedwede Verurteilung von Kriegsverbrechen, ohne Reperationen und Wiedergutmachungsleistungen:
Zwanzig Jahre nach der US-Invasion in den Irak ‒ Erinnerung an ein Menschheitsverbrechen
Vor zwanzig Jahren überfielen die USA den Irak: der Staat wurde zerschlagen, die Wirtschaft ruiniert, die Gesellschaft fragmentiert und die nationale Kultur liquidiert
Ende 2011 mussten die US-amerikanischen Truppen den Irak verlassen. Mit ihren ehrgeizigen Plänen war die Bush-Administration weitgehend gescheitert, die Ausschaltung des Landes als Regionalmacht hatte sie jedoch durch seine Verwüstung und Wandlung in einen "failed state" für lange Zeit gesichert. Die von den Besatzern geschaffenen Konflikte wirken fort und ihre repressive, diskriminierende Politik wurde unter den folgenden irakischen Regierungen fortgesetzt.
Die Bilanz von acht Jahren Krieg und Besatzung war verheerend: mehr als eine Million Tote, über vier Millionen Vertriebene und fast fünf Millionen Waisen. Sieben Millionen Iraker, ein Viertel der Bevölkerung, wurden in die absolute Armut gestürzt, zwei Millionen Kinder waren 2011 unterernährt, dreieinhalb Millionen Menschen ohne nennenswerte Gesundheitsversorgung.
Auch nach acht Jahren war von "Wiederaufbau" nicht viel zu sehen. Über 200 Milliarden US-Dollar sind dafür in die Taschen westlicher Konzerne geflossen, doch die Versorgung blieb katastrophal, Gesundheits- und Bildungswesen lagen noch am Boden.
- vollständiger Text: https://www.telepolis.de/features/Zwanzig-Jahre-nach-der-US-Invasion-in-den-Irak-Erinnerung-an-ein-Menschheitsverbrechen-7550655.html?seite=all
Osteuropa-Expert:innen über Frieden in Ukraine
„Regimewechsel ist kein Kriegsziel“
Von Ulrike Winkelmann, Stefan Reinecke
Putin ist ein Gefangener der neoimperialen Idee, sagen Gwendolyn Sasse und Jörg Baberowski. Ein Streitgespräch über die Einflussmöglichkeiten des Westens.
Schwerpunkt: Krieg in der Ukraine
#taz #tageszeitung #Humboldt-Universität #Osteuropa #Wladimir #Putin #Imperialismus
Die deutsche #Linke und #Russland : Der Verlust der politischen Heimat
#Russland-Romantik und theoretische Belehrungen statt #Solidarität :
Die deutsche Linke versagt im Umgang mit der russischen Aggression in der #Ukraine
#taz #tikhomirova #Krieg #Terror #FuckPutin #Imperialismus
https://taz.de/Die-deutsche-Linke-und-Russland/!5913842/
„Wer den Bedrohten nicht beisteht, hat den Antifaschismus verraten.“

#chrupalla fehlt noch auf dem bild, #afd #linke (in anführungszeichen!) marschieren in der querfront gemeinsam für #putin und den russischen #imperialismus, mit #antifa -schistischen grüssen @(((Dirk Weber))) und @BeatclubFC
ihr seid keine #kommunist!nnen, sondern einfach handlanger des #faschismus!
#politik #gesellschaft #imperialismus #ukraine
"...Viele von uns neigen dazu, die Illusion der Zugehörigkeit zum weißen Mann zu bevorzugen. Uns als Europäer zu sehen. Wie die Deutschen oder Franzosen. Aber die Realität ist, dass wir das nicht sind. Und sie werden uns nie als gleichberechtigt ansehen. Für die imperialen Nationen sind wir die „Wilden“, die „zivilisiert“ werden müssen. Die Quelle für billige Arbeitskräfte, heiße Bräute und Ressourcen, um das Imperium zu ernähren. Nachdem wir „befreit“ und kolonisiert wurden, sind wir der Norden des Globalen Südens. Anstatt also die Stiefel unserer Kolonisatoren zu lecken, sollten wir uns besser mit den anderen Elenden verbinden und von ihren Erfahrungen der dekolonialen Befreiung lernen. Schließlich sind wir dem Neokolonialismus erst in den 1990er Jahren begegnet, während die Menschen in Afrika und Lateinamerika schon viel länger mit dieser Bestie vertraut sind. Sie wissen besser, wie es sich bewegt."
- Anatoli Ulyanov (ein in LA lebender Journalist, bildender Künstler und Dokumentarfilmer aus der Ukraine.) https://www.autonomie-magazin.org/blog/2022/12/07/mein-rosa-sozialismus-wurde-rot-wie-eine-wunde/
#politik #wirtschaft #krieg #corona #impfpolitik #eu #ausbeutung #rohstoffe #sanktionsregime #imperialismus
Propagandamythos Wertegemeinschaft
Coronapandemie und Ukraine-Krieg entlarven Heuchelei der EU in Südamerika. Ignoranz gegenüber Forderungen und Ansichten (Von Jörg Kronauer)
An hehren Begriffen mangelt es nicht, die in Deutschland und der EU so gerne genutzt werden, um die Beziehungen zu den Staaten Lateinamerikas und der Karibik zu preisen: »Gemeinsame Werte«, »Dialog auf Augenhöhe«, »strategische Partnerschaft«. Sie zielen immer auch auf das eigene Publikum, auf »die Europäer«, die sich etwa »den Chinesen« überlegen fühlen sollen. Haben die es nicht – das bekommt man hierzulande ja seit langen Jahren mit der Brechstange eingebläut – auch in Lateinamerika nie auf »Werte«, sondern immer nur auf Rohstoffe und Schuldenfallen abgesehen? Na also.
Die regierungsnahe Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) räumt in einer kürzlich publizierten Analyse dankenswerterweise ein wenig mit den kruden europäischen Propagandamythen auf. Dabei handle es sich um »eine von Wunschdenken bestimmte Rhetorik«, die aber »der Wirklichkeit im wechselseitigen Verhältnis immer weniger gerecht wird«, schreibt der Thinktank; vielmehr müsse man angesichts der Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika konstatieren: »Die gemeinsame Grundlage bröckelt.« Die SWP verdeutlicht das an gleich zwei einschneidenden Großereignissen – an der Covid-19-Pandemie und am Ukraine-Krieg.
Beispiel Pandemie: Von ihr war Lateinamerika – acht Prozent der Weltbevölkerung, 26 Prozent der Covid-19-Todesfälle weltweit – besonders stark betroffen. Impfstoffe bekam es aus der EU faktisch nicht. »Kostengünstige Vakzine aus Russland und China« dagegen konnten in zahlreichen Ländern der Region »besonders schnell in großem Umfang eingeführt und verabreicht werden«, hält die SWP fest. Die Reaktion der EU-Staaten darauf? Sie hätten »Moskaus und Pekings ›Impfdiplomatie‹ gegenüber dem Globalen Süden aufs schärfste« kritisiert, ruft die SWP in Erinnerung. Gleichzeitig hätten sie dafür gesorgt, dass lediglich Vakzine aus der EU, aus Großbritannien und den USA bei »Einreisen in die Union anerkannt wurden«. WHO-Appelle, dafür auch chinesische und russische Impfstoffe zuzulassen, seien zu Lasten einreisewilliger Lateinamerikaner ebenso ignoriert worden wie sämtliche Forderungen, Covid-19-Impfstoffe »als globale öffentliche Güter zu behandeln und entsprechende Patentrechte für eine befristete Zeit zu lockern«. Dass der »Egoismus Europas« doch »weit abfalle von seinen üblichen Solidaritätsbekundungen«, sei in Lateinamerika als schmerzhaft wahrgenommen worden, konstatiert die SWP.
Beispiel Ukraine-Krieg: Für viele Staaten Lateinamerikas und der Karibik habe in den vergangenen Jahren »der Ausbau ihrer (vor allem ökonomischen) Beziehungen zu Staaten wie China, Russland und dem Iran eine Chance auf außenpolitische wie außenwirtschaftliche Diversifizierung« geboten, hält die SWP fest. Dass die westlichen Mächte seit dem 24. Februar nun auch von den Staaten Lateinamerikas forderten, die »von EU und NATO gewählte Gegenstrategie der Stärke« mitzutragen, »die auf Isolierung, Sanktionen und Aufrüstung setzt«, habe weithin ablehnende Reaktionen ausgelöst. Aus lateinamerikanischer Perspektive werde damit »nur die europäische Sichtweise transportiert und ein auf Europa beschränktes Kriegsgeschehen zum Wendepunkt der internationalen Politik erklärt«, berichtet die SWP. Eine Politik der Isolierung werde auf dem Subkontinent ohnehin ebenso wenig für gut befunden wie die zahlreichen westlichen Sanktionskriege: »Exklusion wird als eine Strategie der Mächtigen bewertet, die sich in künftigen Fällen auch gegen das eigene Land richten könnte.« Entsprechend beteiligen sich alle souveränen Staaten der Region – Französisch-Guayana wird bis heute von Paris beherrscht – nicht an den Russland-Sanktionen.
Und es kommt hinzu: Der Ukraine-Krieg hat, resümiert die SWP, »die Annäherung zwischen der EU und Washington gefördert«. Die habe »aus lateinamerikanischer Perspektive« zur Folge, »dass Europa als ›dritte Option‹ neben den USA und China an Strahlkraft verliert«. Damit büßt aber auch das Bemühen um Kooperation mit ihr an Attraktivität ein.
- https://www.jungewelt.de/artikel/441115.politik-der-isolierung-propagandamythos-wertegemeinschaft.html
Von gemeinsamen Werten zu komplementären Interessen - Für eine Neukonzeption der Beziehungen Deutschlands und der EU mit Lateinamerika und der Karibik (SWP-Aktuell 2022/A 78, 15.12.2022)
#politik #lateinamerika #peru #regime-change #putschismus #rechtausleger #gewalt #imperialismus #schweigen #wegschauen #wertewesten
Es manifestiert sich einmal wieder. In Lateinamerika reicht es für die Linke nicht Wahlen zu gewinnen. Diese Wahlsiege müssen mit Zähnen und Klauen bzw. der militanten Unterstützung der Bevölkerung gegen Intrigen des alten Staatsapparats, rechte und opportunistische bürgerliche linke Politiker:innen + Konzernmedien vereidigt werden. Was Lula da Silva, seine Regierung und die progressive Bevölkerung Brasiliens noch erwartet kann man am Bsp. Peru erahnen. Der Wertewesten schaut lieber weg oder ist in diese Anti-Demokratiespiele involviert. Kein Wunder, dass USA, EU, NATO im globalen Süden keine Freunde mehr hat, außer eben jene reaktionären Kräfte. Denkt mal darüber nach.
Peru: "Ein Putsch der Rechten"
Nach der Absetzung des Präsidenten Pedro Castillo haben sich die Straßen Perus wieder mit Menschen gefüllt, die einen tiefgreifenden Wandel in der peruanischen Politik fordern (Von Daniela Ortiz)
Bislang wurden mindestens 21 Demonstrierende durch Repressionskräfte getötet1. Um die Ereignisse besser zu verstehen, haben wir mit der antirassistischen und feministischen Künstlerin Daniela Ortiz gesprochen. Sie wurde im südperuanischen Cusco geboren und befindet sich momentan wieder dort – einer der Städte, in denen ein Generalstreik stattfindet.
Wie bewertest du die Ereignisse der letzten Tage in Peru?
Pedro Castillo hatte die Wahl im Juni 2021 mit den Stimmen der Mehrheit der Peruaner:innen gewonnen. Aber was wir seit Tagen beobachten, ist die Konsequenz der Reaktion der Rechten, des Fujimorismus2 und der politischen und medialen Kräfte auf die Wahl Castillos. All diese Kräfte haben diese Wahl nicht akzeptiert.
Anfangs gingen sie sogar so weit, Wahlhelfer:innen anzuklagen und strafrechtlich zu verfolgen, indem sie ihnen Wahlbetrug vorwarfen. Seitdem haben sie nicht aufgehört, die Regierung zu boykottieren und sie, sowie die Bevölkerung, die Castillo zum Präsidenten gewählt hatte, anzugreifen. Es hat mehrere Versuche gegeben, die Regierung abzusetzen, es gab verschiedene Angriffe und den Missbrauch des Rechtssystems, um politischen Gegner:innen zu schaden.
Das betraf nicht nur Pedro Castillo, sondern alle Minister:innen und politischen Funktionär:innen in seinem Umfeld. Beispielsweise Vladimir Cerrón, der Vorsitzende von Perú Libre (Freies Peru), der Partei, mit der Castillo an die Regierung gekommen war. Gegen ihn laufen über 16 Verfahren wegen Manipulation des Rechtssystems. Diese Art der politischen Verfolgung bezeichnen wir als lawfare. Die Strategie wurde auch auf die Familienangehörigen ausgeweitet. Es sei daran erinnert, dass die Tochter von Castillo durch eine komplette Manipulation des Rechtsrahmens in Vorbeugehaft genommen wurde, um eine feindselige Stimmung gegen ihn zu erzeugen.
Dazu haben wir eine mediale Manipulation gesehen, mit Lügen, die völlig straflos geblieben sind und die ein einziges Ziel hatten: Castillo zu beseitigen, und zwar ihn nicht nur von der Macht zu entfernen, sondern ins Gefängnis zu bringen. Das ist auch ein Akt der Belehrung der Bevölkerung. Damit niemand aus der arbeitenden Klasse, niemand vom Land, kein Dorflehrer oder Gewerkschafter wie Pedro Castillo sich jemals wieder traut, sich zur Wahl aufzustellen und zu gewinnen. Denn das tun sie: Sie erteilen einem großen Teil des Landes eine Lektion.
Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass die imperialistische Macht in der Region an Einfluss verliert. Unsere lateinamerikanischen Brüder und Schwestern haben ebenfalls linke Kandidaten gewählt: Petro in Kolumbien, Lula in Brasilien, Boric in Chile. Dazu kommen Länder wie Venezuela und Kuba, deren linke Regierungen dauerhaft bedroht werden. In Peru werden jetzt die Menschen, die protestieren, in den Medien auf brutale Weise kriminalisiert. Mehrere Menschen wurden bereits durch die Polizei getötet, einer davon war 15 Jahre alt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass durch die jüngsten Wahlen von linken Amtsträger:innen in der Region die USA und die imperialistischen Kräfte in Lateinamerika an Macht verlieren.
- vollständiger Artikel bzw. Interview: https://amerika21.de/blog/2022/12/261679/peru-ein-putsch-der-rechten
#politik #krieg #ukraine #russland #nato #wertewesten #kapitalismus #imperialismus #energiearmut #proteste #unruhen #armut #unterversorgung
Russland-Sanktionen und die Folgen für den globalen Süden
Die Zwangsmaßnahmen, die »in der Frühphase des russisch-ukrainischen Krieges gestartet wurden«, sei es der Ausschluss russischer Banken vom Zahlungssystem SWIFT, seien es die Embargos gegen russische Energieträger, verursachten Kollateralschäden, von denen ungewiss sei, ob insbesondere die Schwellen- und Entwicklungsländer sie bewältigen könnten.
Dass Erdgas teuer geworden ist, hat Folgen für die Verbraucher, und zwar vor allem für die ärmeren unter ihnen. Das gilt schon für die Bundesrepublik und für Europa, also für die eigentlich wohlhabenderen Regionen der Welt. Umso härter trifft es diejenigen Staaten, die kein Wohlstandspolster haben: Für sie wirkt sich der Anstieg des Gaspreises verheerend aus. Nicht anders ist es beim Erdöl, dessen Preis ebenso in die Höhe getrieben worden ist und der bald erneut nach oben schnellen könnte – zum 5. Dezember, wenn die EU nicht nur ihr Embargo in Kraft setzen, sondern außerdem einen weltweiten Preisdeckel für russisches Öl erzwingen will. Beide Maßnahmen, warnte US-Finanzministerin Janet Yellen bereits Mitte September, könnten innerhalb kürzester Zeit zu neuen Höchstpreisen beim Erdöl führen. Die Folgen? Schon im Sommer brachen Proteste in Ecuador, Ghana und Nepal los, weil Benzin für allzu viele unbezahlbar wurde; allein in Indonesien habe es 2022 bislang mehr als 600 Protestaktionen gegeben, hielt die BBC Mitte Oktober in einem penibel recherchierten Überblick fest – ein Vielfaches der gerade einmal 19 Protestaktionen im Jahr 2021. Unruhen verzeichneten bis zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 90 Länder auf allen Kontinenten.
Europa kauft auf
Die Folgen des westlichen Versuchs, auf russische Energierohstoffe zu verzichten, reichen über den globalen Anstieg der Energiepreise hinaus. So hat das Bestreben der europäischen Staaten, so rasch wie möglich aus dem Bezug russischen Pipelinegases auszusteigen, zu einer beispiellosen Jagd nach Flüssigerdgas geführt: Europa kauft, was es nur kriegen kann. Das Problem: Die weltweit vorhandene Menge an LNG ist nicht unendlich. Anfang November konstatierte Torbjörn Törnqvist, Geschäftsführer von Gunvor, dem viertgrößten Ölhandelsunternehmens weltweit, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg: »Wir sollten nicht vergessen, dass den Anteil am Flüssigerdgas, den wir kriegen, jemand anderes nicht bekommt.« Dieser »jemand«, das sind in der globalen Konkurrenz diejenigen, die im Preiskampf irgendwann nicht mehr mithalten können: die ärmeren Länder. Pakistans Energieminister Musadik Malik beispielsweise berichtete Anfang Juli resigniert: »Jedes einzelne Molekül, das in unserer Region erhältlich war, ist von Europa gekauft worden.« Warum? »Weil sie ihre Abhängigkeit von Russland verringern wollen.«
Statistiken aus der Energiebranche bestätigten damals Maliks Angaben. Das auf Energie und Rohstoffe spezialisierte britische Beratungsunternehmen Wood Mackenzie teilte mit, die europäischen Staaten hätten ihre Flüssigerdgasimporte vom 1. Januar bis zum 19. Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 Prozent gesteigert; dazu hätten sie ihre überlegene Kaufkraft genutzt. Andere seien deshalb zu kurz gekommen: Pakistan etwa, das im selben Zeitraum ganze 15 Prozent weniger LNG habe einführen können als im Jahr zuvor, oder Indien, das 16 Prozent weniger importiert habe. Nicht einmal Lieferungen, die ärmere Staaten sich mit langfristigen Vereinbarungen gesichert zu haben glaubten, waren vor dem Zugriff der Europäer geschützt: Bei den astronomischen Preisen lohnte es sich für Erdgashändler immer wieder, Lieferverträge zu brechen, die deshalb fälligen Strafen zu zahlen, aber viel höhere Summen durch Lieferungen nach Europa zu kassieren. Ein Wood-Mackenzie-Experte stellte konsterniert fest: »Die europäische Gaskrise« – genauer: der unbedingte Wille, russisches Erdgas vom Markt zu drängen – »saugt die Welt bis aufs Blut aus«.
Wozu das führt, kann man exemplarisch in Pakistan beobachten. Bereits Mitte April teilte die Regierung des Landes mit, sie müsse die Stromversorgung künftig drosseln: Die Preise für Flüssiggas seien nicht mehr zu stemmen, und ohnehin hätten LNG-Händler zuletzt fest vereinbarte Lieferungen kurzfristig abgesagt. Anfang Juli berichtete Islamabad, eine LNG-Ausschreibung für rund eine Milliarde US-Dollar habe kein einziges Angebot eingebracht; bei den drei vorigen Ausschreibungen sei gerade mal eines eingegangen – allerdings eines, das unbezahlbar gewesen sei. Die Regierung war gezwungen, Gas zu rationieren; sie kürzte die Arbeitsstunden im öffentlichen Dienst, nötigte Einkaufszentren, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren, und erzwang in der ersten Juliwoche gar Betriebsstilllegungen in der für das Land wichtigen Textilindustrie, um Gas für die noch wichtigere Düngemittelproduktion zu sparen. Beobachter warnten, die Textilproduktion, die ohnehin bereits merklich geschrumpft sei, könne noch weiter einbrechen; für die pakistanische Wirtschaft sei das fatal.
Seitdem ist die Lage nicht besser geworden. Während Flüssiggastanker vor den europäischen Küsten kreuzen und warten, bis dort Entladestellen an LNG-Terminals frei werden oder die Preise weiter steigen, gelingt es der pakistanischen Regierung nicht, sich Erdgas in ausreichendem Umfang zu verschaffen. Prinzipiell könnte man Lagerstätten im eigenen Land anzapfen; nur: Das Interesse bei den ausländischen Großkonzernen, die die Fähigkeiten dazu besitzen, ist gering. Pakistan gilt – nicht zu Unrecht – als politisch instabil, also als Risikogebiet. Längst diskutiert Islamabad, ob man nicht Pipelines aus Russland oder aus dem Iran bauen soll. Eine Leitung aus dem Iran ist ohnehin seit vielen Jahren im Gespräch, wird aber von den USA kompromisslos bekämpft. Eine Pipeline aus Russland wiederum wird voraussichtlich an den westlichen Sanktionen scheitern. Was tun? Am 10. November teilte ein Mitarbeiter des Energieministeriums mit, Islamabad bereite für den Winter weitere Rationierungsmaßnahmen vor. Privathaushalte würden dann nur noch für drei Stunden am Morgen, zwei Stunden am Nachmittag und drei Stunden am Abend mit Gas versorgt; mehr sei nicht drin. 16 Stunden am Tag werde ihnen das Gas also abgedreht.
Pakistan mit seinen gut 240 Millionen Einwohnern ist kein Einzelfall. Hart getroffen wird auch Bangladesch (165 Millionen Einwohner). Auch dort kann Flüssiggas kaum noch bezahlt werden. Auch dort mussten bereits im Juli der Strom rationiert, Arbeitsstunden gekürzt und die Nutzung von Klimaanlagen strikt reglementiert werden. Auch dort traf es – und trifft es bis heute – neben Privathaushalten die aufkeimende Industrie des Landes, die nach Jahrzehnten eklatanter Schwäche endlich in einer Hoffnung verheißenden Phase des Aufschwungs angekommen war. Vor allem die Textilindustrie leide, müsse immer wieder Betriebe stilllegen, weil diese nicht zuverlässig mit Energie versorgt würden, berichtete Anfang November ein Spezialist von der Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) in Dhaka der Deutschen Welle. Ähnlich sieht es in weiteren Ländern Süd- und Südostasiens aus – und die Aussichten sind trübe: Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete kürzlich, Europas Bedarf an Flüssiggas werde weiter steigen, wohl um fast 60 Prozent bis 2026. Was das für den Rest der Welt heißt, soweit er bislang LNG nutzte, liegt auf der Hand.
- vollständiger Artikel: https://www.jungewelt.de/artikel/439354.imperialismus-weltweiter-schaden.html
#politik #wirtschaft #kolonialismus #imperialismus #ausbeutung #white-supremacy #rassismus #kapitalismus
Das Ende der »kolumbianischen Epoche«
Die Verringerung der »globalen Ungleichheit« hat [...] eine enorme Bedeutung. Um so mehr, als diese ein fürchterliches Zwangsverhältnis möglich gemacht hat, das bis heute nur langsam abstirbt. Schon Adam Smith hatte festgestellt, dass zur Zeit der Entdeckung/Eroberung Amerikas (und damit zu Beginn der »kolumbianischen Epoche«) die »Überlegenheit« der Europäer sich als so groß erwies, dass diese ungestraft jede Art von Ungerechtigkeit in den fernen Ländern begehen konnten. Sehr viel später richtete Hitler das Wort an die deutschen Industriellen: »Die weiße Rasse kann aber ihre Stellung nur dann praktisch aufrechterhalten, wenn die Verschiedenartigkeit des Lebensstandards in der Welt aufrechterhalten bleibt.« (…) Man müsse die Sowjetunion ins Visier nehmen, die sich »mit Hilfe der Krücken der kapitalistischen Wirtschaft« anschicke, für die Länder der weißen Rasse zum »schwersten wirtschaftlichen Konkurrenten« zu werden. In Verteidigung dessen, was wir heute »globale Ungleichheit« nennen, war Hitler bereit, einen der grausamsten reaktionären Klassenkämpfe zu entfesseln, den die Weltgeschichte je gesehen hat.
- von Domenico Losurdo
Heute geht es um China. Mehr ist dazu nicht zu sagen
#politik #krieg #geschichtsrevisionismus #russophobie #imperialismus #kapitalismus #klima #weltzerstörung
Kaputter Kapitalismus = Beschleunigte Zerstörung
Eine gleichgültige Classe politique tritt den Marsch in den Abgrund an. Über den Krieg in der Ukraine, über Bellizismus und die Zukunft des Kapitalismus (Von Karl-Heinz Dellwo)
In keinem Land scheint der Russenhass so schnell aktivierbar zu sein wie in Deutschland¹, das nun zum fünften Mal daran beteiligt ist, Russland vom Westen her seinem Europa zu unterwerfen.² Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gab direkt nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine die alte Naziparole aus, nach der die russische Industrie zu vernichten und Russland zu einem Agrarland zu machen sei.³
Krieg als Befreiungsschlag
Diese Schnelligkeit, mit der hier altnazistische Parolen aktiviert werden und mit der eine politisch mehr oder weniger unbeleckte neue Politik- und Medienkaste, die gerade noch das Loblied des »grünen Kapitalismus« sang, in den Kriegsmodus schalten konnte, verweist auf eine historische Fäulnis des Bisherigen und weckt seltsame Assoziationen zur Vorkriegszeit und zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Als der 1914 begann, öffneten sich alle gesellschaftlichen Schleusen. Schnell waren alle politischen Unterschiede eingeebnet: Bis auf eine marginale Minderheit wollte sich jeder am Krieg beteiligen. Die Sozialdemokraten liefen zum Kaisertum über (und haben sich von diesem Verrat inhaltlich nie wieder erholt). Der Kaiser kannte bekanntlich keine Parteien mehr, sondern nur noch deutsche Vaterlandsverteidiger. Die Jugend orientierte sich an der national-idealistisch mystifizierten Schlacht in Langemarck im November 1914, eine vom deutschen Heer militärisch dümmlich organisierte Kriegsaktion ohne jede Relation zu den erreichbaren Zielen, aber mit großen Opfern – Futter für den verlogenen Patriotismus.
Die 20 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkrieges erinnern an die 20 Jahre vor Beginn des neuen Bellizismus heute. Der imperialistische Kaiserstaat dümpelte vor sich hin, die Gesellschaft war öde, eingemottet. Eine Antwort auf die Frage, wie sich die Zukunft gestalten ließe, gab es nicht, da eine Änderung des auf der Dreifaltigkeit von Gott, Kaiser und Vaterland beruhenden Systems hin zu einem modernen Kapitalismus ausgeschlossen schien und sich keine Akteure fanden, um diese umzusetzen. Der Ausbruch des Krieges war das Resultat eines längst vorangeschrittenen Zerfalls. Mariupol ist nur geographisch von Langemarck in Belgisch-Flandern entfernt. Bezogen auf die verlogene Mystifizierung, diesmal nicht durch eine Oberste Heeresleitung, sondern eine NATO-affine Journalistenbrigade in der Etappe, liegen die Orte fast deckungsgleich aufeinander, wobei es gar nicht so leicht ist, aus den Bandera-Faschisten und den aus verschiedenen Ländern hinzugeströmten Rechtsradikalen und Neofaschisten eine politisch-moralisch ansehnliche Kampfgruppe zu machen.
Goebbels’ »Eintopfsonntag«
Hier zeigt sich vielleicht ein anderer Hintergrund für die offenkundige Kriegsgeilheit eines Teils der neuen politischen und medialen Kaste: Sie sind allem überdrüssig. Sie sehnen sich danach, von der Unmöglichkeit erlöst zu werden, das systemimmanent Nichtänderbare als unter ihrer Kontrolle stehend darzustellen und ins Glückliche wenden zu können. Die neue Liebe zum Bellizismus und zum Traum vom militärischen Sieg gegen konkurrierende Systeme enthüllt ebenso: Es gibt keine Lösung für ihr postuliertes Projekt des plötzlich vom Menschen und nicht mehr vom abstrakten Wert ausgehenden Kapitalismus. Sie wissen es längst: All ihre Versprechungen werden unerfüllt bleiben. Sie werden wie in der Vergangenheit jede soziale, ökologische und politische Position räumen, die politisch oder ökonomisch den Gesetzen der Marktlogik widerspricht.
Längst ist schon wieder möglich, was gestern für immer verworfen und ad acta gelegt worden war: Atomkraft, Weiternutzung der fossilen Energieträger Kohle, Öl bis hin zum Gasfracking, Zentralverwaltung der Energiewirtschaft als Teil einer neuen Kriegswirtschaft, und statt Winterhilfswerk für die Wehrmacht: »Frieren für den Sieg!« Der Verzicht wird von oben propagiert. Die öffentlich hochgehaltene Moral der Entbehrung offenbart seltsam zutreffende Analogien, beispielsweise zum »Eintopfsonntag«⁴, zu dem die Naziführung ab Oktober 1933 die Bevölkerung anhielt. Diese neue, von oben propagierte gesellschaftliche Pflicht, verbunden mit der Aufforderung, jeweils 50 Pfennige für das Winterhilfswerk zu spenden, war als gemeinschaftsbildende Aktion gegen den Feind gedacht. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurde der »Eintopfsonntag« dann noch religiös aufgeladen, indem er zum »Opfersonntag« umdefiniert wurde.
Die Politik hat sich längst in zwei völlig voneinander geschiedene Sphären geteilt: Es gibt die Politik des An-die-Macht-Kommens, und es gibt die Politik vom Standpunkt der Macht aus. Beide haben am Ende nur wenig miteinander zu tun. Vor allem aber: Keine besitzt Souveränität gegenüber der Ökonomie. Ihre Aufgabe scheint es zu sein, im Sinne von Roland Barthes »das Leben abzuführen« und der Herrschaft der Verwertung alle Macht zu übertragen.....
- Das ist nur der Anfang. Den ganzen Text gibt es hier https://www.jungewelt.de/artikel/437750.kaputter-kapitalismus-beschleunigte-zerst%C3%B6rung.html und demnächst auch hier https://www.crisiscritique.org/
#politik #wirtschaft #ausbeutung #arbeit #lohnsklaverei #kolonialismus #imperialismus
"Die internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass sich einige Länder auf das Gewinnen und andere auf das Verlieren spezialisieren"
- Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas
Sehr guter Artikel zum Thema: Kuba: Kapitalismus, Unterentwicklung und das Ziel, beides zu überwinden - Ist das System der Ausfuhr einer Monoproduktion erst einmal etabliert, gibt es keinen Ausweg aus dem "Käfig der Unterentwicklung" (amerika21)
#politik # Weltordnung #wertewesten #propaganda #imperialismus
Die alten Zentren des Imperialismus glaubten die Welt im Griff zu haben. Die Legende vom Ende der Geschichte nach 1989/90 war ein aus Überheblichkeit gespeister Irrtum. Stattdessen begann eine neue, auch gewalttätige Geschichte, in der es um die Neuaufteilung dieser Welt geht. Da werden nicht nur Demokratie und Freiheit verteidigt, sondern zuerst die bisherigen globalen Herrschaftsverhältnisse, die mehr als genug Unheil angerichtet haben. Wer diese Dimension ausblendet, lügt sich selbst und anderen in die Tasche.
Die globale Perspektive – Imperialismus und Widerstand
Imperialismus – kaum ein Schlagwort wird so sinnentleert benutzt wie dieses. Während aktuell von westlichen Regierungen der „russische Imperialismus“, gemeint ist der Angriffskrieg in der Ukraine, gegeißelt wird, wird das eigene militärische Agieren und die Unterstützung antikommunistischer Putsch- und Regierungsprojekte auf allen Kontinenten selbstverständlich nicht unter diesem Begriff gefasst, genausowenig die ökonomischen Bedingungen, die zu weltweit krasser Ungleichheit führen. Aber auch für Teile der Linken, insbesondere in Deutschland, sind Imperialismus und auch Antiimperialismus begriffliche Leerstellen, bzw. Codewort für irgendwas, das man beides in der Vergangenheit verortet und irgendwie schlimm ist. Damit das nicht so bleibt haben wir das Buch „Die globale Perspektive“ von Torkil Lauesen herausgegeben, in der Hoffnung, diese Leerstelle aus linker, revolutionärer Perspektive zumindest etwas füllen zu können. Wir veröffentlichen hier unser Vorwort zum Buch, das Ihr in der Buchhandlung eures Vertrauens, oder direkt beim Unrast-Verlag bestellen könnt.
#politik #weltordnung #uno #trikont #imperialismus
...Die Welt ordnet sich neu. China und Russland lehnen eine unilaterale Ordnung ab. Wie werden sich am Ende Indien, Pakistan, Brasilien, der Senegal, der Kongo und andere entscheiden? Am Ende stehen sich zwei große Lager gegenüber. Von denen freilich das kleinere zur Zeit immer noch kleiner wird. Aber es bleibt sich treu. Es setzt – wie gehabt, nachdem die koloniale Ordnung für immer dahin ist – auf koloniales Chaos, mag es kosten, was es wolle. Hauptsache billige Rohstoffe. Dagegen stellt das Lager des Trikont – es repräsentiert, so zögerlich wie auffällig zusammenwachsend, im Moment etwa Dreiviertel der Weltbevölkerung – die Forderung nach einer veränderten Weltordnung. Nach den Regeln einer entsprechend den veränderten Kräfteverhältnissen neugestalteten UNO besinnen sich die Völker vielleicht endlich darauf, sich auf Augenhöhe zu begegnen, es wird endlich das schöne Wort »fair« nicht mehr den albernen Wortspielen des Marketing vorbehalten sein, und niemand wird mehr hämisch und bösartig über China herfallen oder über sonst wen, der nicht spurt. Soweit ist es noch nicht.....
#politik #macht #imperialismus #usa
»Wem es hauptsächlich um Werte geht, sollte nicht den diplomatischen Dienst, sondern das Priesteramt anstreben.«
- Henry Kissinger (Exaußenminister, Friedensnobelpreisträger und Organisator des Staatsstreiches in Chile, mit dem 1973 die demokratisch gewählte Regierung der Unidad Popular weggeputscht worden war)
....Egon Bahr, Spiritus rector der neuen Ostpolitik der SPD, lag mit seiner deutlichen Ansage gegenüber Gymnasiasten nicht weit davon entfernt:
»In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.«
Der 2015 verstorbene Bahr, nach eigenem Bekunden einst selbst ein Kalter Krieger, berief sich bei der Frage nach seiner aktuellen politischen Verortung auf seinen Freund Willy Brandt. Der habe gesagt, je älter er werde, desto linker werde er. »Mir geht es nicht anders.« Sein Urteil über die USA hatte eventuell nichts mit dieser linken Haltung zu tun, sondern war einfach nur logisch und vernünftig. »Das nationale Interesse der USA ist von der moralischen Gewissheit durchdrungen, das auserwählte Volk Gottes zu sein. Nationalbewusstsein und Sendungsbewusstsein sind unlöslich verschmolzen«, konstatierte er 2015. Und fast schon resignativ fügte er an, dass es »sinnlos« sei, dies zu kritisieren.
»Die amerikanische Position stellt einen moralischen Maßstab dar, der nicht verhandelbar ist. Das entspricht auch der amerikanischen Haltung, sich nicht durch fremde Ordnungen binden zu lassen. Das hat mit Macht und weniger mit Werten zu tun. Die Globalmacht USA wird sich nur binden, wo ihr Interesse das rät. Sie wird insgesamt ihre Politik der freien Hand verfolgen, um ihren Einfluss zu vergrößern.«
Das war eine sehr diplomatische, sehr höfliche Umschreibung für die Durchsetzung einer neuen Weltordnung, die sich die USA in ihre internen Strategiepapiere und auf ihre Fahne geschrieben hatten.
- aus Weltmacht mit allen Mitteln - An einer friedlichen Ordnung des Planeten haben die USA nie Interesse gezeigt. In Washington gilt einzig die rücksichtslose Aufrechterhaltung der eigenen Dominanz (Von Klaus Eichner)
https://www.jungewelt.de/artikel/436908.imperialismus-weltmacht-mit-allen-mitteln.html
#politik #krieg #imperialismus #analyse #kritik #vernunft
Alle gleich imperialistisch? Warum sympathische Haltung keine Analyse ersetzen kann
- von Alexander Amethystow | LCM
....Wenn von westlicher Seite vom „russischen Imperialismus“ die Rede ist, so ist damit jegliche Einmischung Russlands in die Politik anderen Staaten und vor allem gegenüber Anrainern gemeint. Dahinter steckt kein irgendwie theoretisch avancierter Begriff von „Imperialismus“. Das sieht man schon daran, dass die Einmischung des Westens, egal wo, prinzipiell nicht als Regelbruch, sondern als regelkonformes Wahrnehmen der eigenen legitimen Interessen wahrgenommen wird. Es gibt Linke, die den Begriff „Imperialismus“ ebenfalls so nutzen, dass ein militärischer Einmarsch von wem auch immer wohin auch immer so betitelt wird ohne weitere Analyse von Interessen und Machtpotenzial der Akteure. Nicht, dass die Gründe Nigerias bei den zahlreichen Interventionen in die benachbarten westafrikanischen Länder irgendwie sympathischer wären als die der USA in Irak, Afghanistan oder Libyen – aber es sind andere.
Der derzeit kursierende Plakatspruch „Es gibt nur einen Imperialismus – den gegen die Menschen“ bereichert die Analyse um keine richtige Erkenntnis. Die führenden kapitalistischen Mächte tragen heute selten Konflikte um Gebietsgewinne aus und versuchen nicht, verfeindete Staaten direkt ihrer Souveränität zu berauben. Sie diktieren vielmehr jene Verträge, die sie als Souverän mit anderem Souverän abschließen, aber zu ihren Bedingungen. So wollen sie die Souveränität anderer Staaten für die Interessen eigener Kapitale und für sich als Staat nützlich machen. Russlands Versuch die ukrainische Souveränität für die eigene Zwecke zu nutzen hat vorläufig nicht geklappt und nun kommt so eine „altmodische“ Methode, wie territoriale Zergliederung zum Einsatz.
Russland bleibt ein in der Konkurrenz unterlegener Staat, dessen Ressourcen die Kapitale der erfolgreicheren Mächte gerne nutzen würden. Russische Kriegsziele sind deswegen nicht „antiimperialistisch“. Die Invasion der Ukraine istRusslands Versuch, die vorhandenen Gewaltmittel dafür einzusetzen, die Rahmenbedingungen zu eigenen Gunsten zu ändern.Es ist richtig, keine der beiden Kriegsparteien zu unterstützen, für eine echte Position gegen den Krieg können die Unterschiede der Positionen und Praktiken der Kriegsparteien aber nicht ignoriert werden.
- vollständiger Text: https://lowerclassmag.com/2022/10/08/alle-gleich-imperialistisch-warum-sympathische-haltung-keine-analyse-ersetzen-kann/
#politik #krieg #hegemonie #imperialismus #usa #taiwan #china #zoologie
US-Imperialismus: Ukraine als Vorbild
USA wollen Taiwan bis an die Zähne bewaffnen und China in einen langen Krieg ziehen (Von Jörg Kronauer)
Ein »Stachelschwein«: Das ist das Bild, das US-Militärs seit einiger Zeit nutzen, wenn sie ihre Vorstellungen von einer für Taiwan angemessenen Verteidigungsstrategie formulieren. Dahinter steckt ein Streit zwischen Washington und Taipeh darüber, wie Taiwan auf einen möglichen militärischen Angriff der Volksrepublik reagieren soll – und welche US-Waffen es dafür braucht. Der Streit prägt auch die jüngsten US-Ankündigungen zur Aufrüstung der Insel, die vor wenigen Tagen hohe Wellen schlugen.
Taiwans Streitkräfte sind eigentlich an einer konventionellen Aufrüstung interessiert. Sie wollen neue US-Kampfjets erwerben, um chinesische Militärflugzeuge vom Eindringen in den taiwanischen Luftraum abzuhalten und um im Kriegsfall Militäreinrichtungen auf dem chinesischen Festland angreifen zu können. Sie haben erst kürzlich ein amphibisches Landungsschiff aus eigener Produktion in Betrieb genommen, um im Fall der Fälle Inseln, die Taipeh kontrolliert, versorgen, vielleicht sogar zum chinesischen Festland vorstoßen zu können. Das Problem dabei: Kriegsschiffe und Kampfjets sowie deren Startbahnen sind Ziele, die die chinesischen Streitkräfte vergleichsweise leicht treffen können. Im Falle eines Krieges halten es US-Militärs für gut möglich, dass sie binnen kürzester Zeit vernichtet werden. Taipeh hätte dann gewaltige Summen für Kriegsgerät verschwendet, das schon die erste Angriffswelle unter Umständen nicht übersteht.
Die Alternative? Nun, man kann sie, sagen US-Militärs, in der Ukraine beobachten. Dort kämpften zu Beginn kleine Einheiten mit tragbaren Panzer- und Flugabwehrwaffen gegen die russischen Streitkräfte – und sie hatten damit durchaus Erfolg. So müsse es auch Taiwan machen, empfehlen US-Strategen: sich bis an die Zähne mit derlei Gerät bewaffnen – wie ein Stachelschwein eben. Dagegen könnten etwaige Invasionstruppen aus der Volksrepublik nur schwer etwas unternehmen. Schmerzliche Verluste wären ihnen ebenso gewiss wie heute Russlands Streitkräften in der Ukraine. Das kleine Problem: Das »Stachelschwein«-Szenario setzt voraus, dass Taiwan eingenommen wird und sich dann in einem lang andauernden Krieg blutig gegen die Volksrepublik auflehnen soll. Wer aber möchte denn wirklich freiwillig so enden wie die Ukraine?
Im Streit um Taiwans Verteidigungsstrategie sitzt freilich Washington am längeren Hebel, denn Taipeh setzt ja zum guten Teil auf Waffen aus den USA. Vor einigen Tagen hat die Biden-Regierung durchstechen lassen, sie wolle nun Nägel mit Köpfen machen und ein milliardenschweres Rüstungspaket für Taiwan schnüren. Das vorige enthielt bereits zahlreiche Schiffsabwehrraketen, während sich die Lieferung der von Taiwan bestellten F-16-Kampfjets – wie es der Zufall so will – immer wieder verzögert. Nun ist die Rede davon, die Insel für den Fall einer chinesischen Blockade prophylaktisch in ein »gigantisches Waffenlager« zu verwandeln, in dem neben handlichen Panzer- und Flugabwehrraketen à la Ukraine alles Gerät zu finden ist, was man für einen Untergrundkrieg braucht; »Stay behind«-Konzepte lassen grüßen. Und während so mancher in Taipeh grummelt oder sogar mächtig schimpft, schafft sich Washington so eigenmächtig das gewünschte »Stachelschwein«.
- https://www.jungewelt.de/artikel/436674.us-imperialismus-ukraine-als-vorbild.html
Reaktion: Sicherheit hat Priorität - Parteitag der KP Chinas: Präsident Xi Jinping schwört Delegierte darauf ein, dem Druck westlicher Machtpolitik standzuhalten
Gastkommentar: Der letzte Kampf des russischen Imperialismus | DW | 08.10.2022
Die Indizien aus der vergangenen Woche sind unübersehbar: Russland geht in der Ukraine einer Niederlage entgegen. Das wurde an Wladimir Putins 70. Geburtstag deutlich sichtbar, meint Jörg Himmelreich.#Russland #Ukraine #WladimirPutin #Imperialismus #Zar #Krieg
Gastkommentar: Der letzte Kampf des russischen Imperialismus | DW | 08.10.2022
#politik #wirtschaft #krieg #russland #eu #nato #usa #imperialismus #sanktionen #energiepreiskrise #wirtschaftskrise #hegemonie
Der Euro ohne deutsche Industrie
Sanktionen gegen Russland führen die EU in die wirtschaftliche Depression. Sabotage von Nord-Stream-Pipelines legt Berlin auf US- und NATO-Kurs fest (Von Michael Hudson)
Der in New York lebende US-Ökonom Michael Hudson (Jahrgang 1939) analysierte bereits 1972 in seinem Standardwerk »Superimperialism« die Strategie der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten. Im folgenden Artikel, den Hudson exklusiv für junge Welt verfasst hat, ordnet er den Wirtschaftskrieg gegen Russland und dessen Folgen ein. (jW)
Die Reaktion auf die Sabotage von drei der vier Nord-Stream-1- und -2-Pipelines an vier Stellen am Montag in der vergangenen Woche hat Spekulationen darüber genährt, wer für die Tat in Frage kommt und ob die NATO einen ernsthaften Versuch unternehmen wird, die Antwort zu finden.
Doch anstelle von Panik herrschte große diplomatische Erleichterung, ja sogar Ruhe. Die Abschaltung der Pipelines beendet die Ungewissheit und die Sorgen von US/NATO-Diplomaten, die in der vergangenen Woche fast ein krisenhaftes Ausmaß erreicht hatten, als in Deutschland mehrere Demonstrationen stattfanden, bei denen die Beendigung der Sanktionen und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zur Behebung der Energieknappheit gefordert wurden.
Die Öffentlichkeit in Deutschland beginnt zu verstehen, was es bedeutet, wenn ihre Stahlunternehmen, Düngemittelfirmen, Glasunternehmen und Toilettenpapierhersteller schließen müssen. Diese Unternehmen rechnen damit, dass sie ihr Geschäft ganz aufgeben – oder in die Vereinigten Staaten verlagern – müssen, wenn Deutschland die Handels- und Währungssanktionen gegen Russland nicht fallenlässt und statt dessen die Wiederaufnahme der russischen Gas- und Öleinfuhren zulässt, was vermutlich die um das Acht- bis Zehnfache gestiegenen Preise wieder sinken lassen würde.
Fakten schaffen
Die Falkin im US-Außenministerium, Victoria Nuland, hatte jedoch bereits im Januar erklärt, dass Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen werde, wenn Russland auf die zunehmenden ukrainischen Militärangriffe auf die russischsprachigen östlichen Oblasten reagiere. Präsident Joseph Biden bekräftigte am 7. Februar das Beharren der USA und versprach, dass es »Nord Stream 2 nicht mehr geben w ird. Wir werden dem ein Ende setzen. (…) Ich verspreche Ihnen, dass wir dazu in der Lage sein werden«.
Die meisten Beobachter gingen davon aus, dass diese Aussagen die offensichtliche Tatsache widerspiegelten, dass deutsche Politiker voll und ganz in der Tasche der USA/NATO steckten. Berlin weigerte sich, Nord Stream 2 zu genehmigen, und Kanada beschlagnahmte bald die Siemens-Dynamos, die benötigt wurden, um Gas durch Nord Stream 1 zu leiten. Damit schien die Angelegenheit erledigt zu sein, bis die deutsche Industrie – und eine wachsende Zahl von Wählern – schließlich zu berechnen begann, was eine Blockade des russischen Gases für die deutschen Industrieunternehmen und damit für die Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten würde.
Die Bereitschaft Deutschlands, sich selbst eine wirtschaftliche Depression aufzuerlegen, schwankte – allerdings nicht bei seinen Politikern oder der EU-Bürokratie. Wenn die politischen Entscheidungsträger die Interessen der deutschen Wirtschaft und den Lebensstandard an die erste Stelle setzen würden, würden die gemeinsamen Sanktionen der NATO und die Front des neuen kalten Krieges durchbrochen. Italien und Frankreich könnten diesem Beispiel folgen. Diese Aussicht machte es dringend erforderlich, die antirussischen Sanktionen aus den Händen der demokratischen Politik zu nehmen.
Obwohl es sich um einen Gewaltakt handelt, hat die Sabotage der Pipelines die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und der NATO wieder beruhigt. Es besteht keine Ungewissheit mehr darüber, ob sich Europa von der US-Diplomatie lösen könnte, indem es den gegenseitigen Handel und die Investitionen mit Russland wieder aufnimmt. Die Gefahr, dass sich Europa von den Handels- und Finanzsanktionen der USA und der NATO gegen Russland lossagt, ist scheinbar auf absehbare Zukunft gebannt. Russland hat bekanntgegeben, dass der Gasdruck in drei der vier Pipelines sinkt und dass das Eindringen von Salzwasser die Rohre irreversibel korrodieren wird.
Währung als Waffe
Wenn man sich anschaut, wie dies das Verhältnis zwischen dem US-Dollar und dem Euro beeinträchtigen wird, kann man verstehen, warum die scheinbar offensichtlichen Folgen eines Abbruchs der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, Italien sowie anderen europäischen Volkswirtschaften und Russland nicht offen diskutiert wurden. Die Lösung ist ein deutscher und in der Tat ein europaweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch. Das nächste Jahrzehnt wird eine Katastrophe sein. Es mag Vorwürfe über den Preis geben, der dafür gezahlt wird, dass die europäische Handelsdiplomatie von der NATO diktiert wurde, aber die europäischen Staaten können nichts dagegen tun. Bislang erwartet (noch) niemand, dass sich die EU in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit rettet. Was erwartet wird, ist, dass der Lebensstandard der Bevölkerung sinkt.
Die Exporte der deutschen Industrie und das Anziehen ausländischer Investitionen waren wichtige Faktoren, die den Wechselkurs des Euro stützten. Für Deutschland bestand der große Anreiz, von der D-Mark zum Euro zu wechseln, darin, zu vermeiden, dass sein Exportüberschuss den Wechselkurs der D-Mark in die Höhe trieb und deutsche Produkte vom Weltmarkt verdrängten. Die Ausweitung der Euro-Zone auf Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und andere Länder mit Zahlungsbilanzdefiziten verhinderte einen Höhenflug des Euro. Das schützte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.
Nach seiner Einführung im Jahr 1999 zu einem Kurs von 1,12 US-Dollar sank der Euro bis Juli 2001 auf 0,85 US-Dollar, erholte sich jedoch und stieg im April 2008 sogar auf 1,58 US-Dollar. Seitdem ist er stetig gesunken, und seit Februar dieses Jahres haben die Sanktionen den Wechselkurs des Euro unter die Parität zum US-Dollar gedrückt, auf 0,97 US-Dollar in dieser Woche.
Strukturelle Krise
Das größte Problem sind die steigenden Preise für importiertes Gas und Öl sowie für Produkte wie Aluminium und Düngemittel, für deren Herstellung viel Energie benötigt wird. Und da der Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar sinkt, steigen die Kosten, um US-Dollar-Schulden zu bedienen – wie es bei Tochtergesellschaften multinationaler US-Unternehmen üblich ist –, und drücken die Gewinne.
Dies ist nicht die Art von Depression, bei der »automatische Stabilisatoren« wirken können, um das wirtschaftliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Energieabhängigkeit ist strukturell bedingt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wirtschaftsregeln der Euro-Zone das Haushaltsdefizit auf nur drei Prozent des BIP begrenzen. Dies verhindert, dass die nationalen Regierungen die Wirtschaft durch Staatsverschuldung stützen. Höhere Energie- und Lebensmittelpreise – und der Schuldendienst in US-Dollar – werden dazu führen, dass viel weniger Einkommen für Waren und Dienstleistungen zur Verfügung steht.
Der Journalist Pepe Escobar wies in einem Beitrag vom 28. September auf dem iranischen Nachrichtensender presstv.ir darauf hin, dass »Deutschland vertraglich verpflichtet ist, bis 2030 mindestens 40 Milliarden Kubikmeter russisches Gas pro Jahr abzunehmen. (…) Gasprom hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, auch ohne Gaslieferungen bezahlt zu werden. … Berlin bekommt nicht alles Gas, was es braucht, muss aber trotzdem zahlen«. Es ist mit einem langen Rechtsstreit zu rechnen, bevor das Geld den Besitzer wechselt. Und letztlich wird die Zahlungsfähigkeit Deutschlands immer schwächer werden.
Es mutet seltsam an, dass die Aktienkurse des Dow Jones Industrial Average in den USA am vergangenen Mittwoch einen Anstieg von mehr als 500 Punkten verzeichneten. Vielleicht hat das »Plunge Protection Team« (»Arbeitsgruppe des Präsidenten zu den Finanzmärkten«, von US-Präsidenten Ronald Reagan 1988 installiert, jW) interveniert, um die Welt zu beruhigen, dass alles in Ordnung sei. Doch am Donnerstag gab der Aktienmarkt den größten Teil dieser Gewinne wieder ab, da die Realität nicht länger beiseite geschoben werden konnte.
Der Wettbewerb der deutschen Industrie mit den Vereinigten Staaten endet, was der US-Handelsbilanz zugute kommt. Auf der Kapitalseite jedoch wird die Abwertung des Euro den Wert der US-Investitionen in Europa und den US-Dollar-Wert der Gewinne, die sie noch erzielen können, verringern, da die europäische Wirtschaft schrumpft. Die von den multinationalen US-Konzernen gemeldeten weltweiten Gewinne werden sinken.
Steigende US-Dollar-Schulden
Die Fähigkeit vieler Länder, ihre Auslands- und Inlandsschulden zu begleichen, war bereits an der Belastungsgrenze angelangt, bevor die antirussischen Sanktionen die Weltmarktpreise für Energie und Lebensmittel in die Höhe trieben. Der sanktionsbedingte Preisanstieg wurde durch den steigenden US-Dollar-Kurs gegenüber fast allen Währungen noch verstärkt (ironischerweise mit Ausnahme des Rubel, dessen Kurs in die Höhe geschnellt ist, anstatt zu kollabieren, wie es die US-Strategen vergeblich zu erreichen versuchten). Die internationalen Rohstoffpreise werden nach wie vor hauptsächlich in US-Dollar angegeben, so dass die Aufwertung des US-Dollar die Importpreise für die meisten Länder weiter in die Höhe treibt.
Der steigende US-Dollar erhöht auch die Kosten für die Bedienung von Auslandsschulden in US-Dollar in der Landeswährung. Viele Länder Europas und des globalen Südens haben bereits die Grenze ihrer Fähigkeit erreicht, ihre auf US-Dollar lautenden Schulden zu bedienen, und haben immer noch mit den Auswirkungen der Covid-Pandemie zu kämpfen. Jetzt, da die Sanktionen der USA und der NATO die Weltmarktpreise für Gas, Öl und Getreide in die Höhe getrieben haben und die Aufwertung des US-Dollar die Kosten für die Bedienung der US-Dollar-Schulden in die Höhe treibt, können diese Länder es sich nicht leisten, die Energie und die Nahrungsmittel zu importieren, die sie zum Leben brauchen, wenn sie ihre Auslandsschulden bezahlen müssen. Irgend etwas muss also passieren.
Alternative zur Barberei
Am Dienstag vergangener Woche vergoss US-Außenminister Antony Blinken Krokodilstränen und erklärte, ein Angriff auf russische Pipelines sei »in niemandes Interesse«. Aber wenn das wirklich der Fall wäre, hätte niemand die Gasleitungen angegriffen. Was Blinken wirklich sagen wollte, war: »Frag nicht Cui bono.« Ich gehe nicht davon aus, dass die NATO-Ermittler über die Beschuldigung der üblichen Verdächtigen hinausgehen, die von den US-Beamten automatisch verantwortlich gemacht werden.
Die US-Strategen müssen einen Plan haben, wie sie weiter vorgehen wollen. Sie werden versuchen, eine neoliberalisierte Weltwirtschaft so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Sie werden die übliche Masche für Länder anwenden, die ihre Auslandsschulden nicht bezahlen können: Der IWF wird ihnen das Geld leihen, um sie zu bezahlen – unter der Bedingung, dass sie die Devisen für die Rückzahlung aufbringen, indem sie privatisieren, was von ihrem öffentlichen Eigentum, ihren natürlichen Ressourcen und anderen Vermögenswerten übrig ist, und sie an US-Finanzinvestoren und ihre Verbündeten verkaufen.
Die große Sorge der US-Strategen ist, dass sich Staaten zu einer Alternative zu der von Washington entworfenen neoliberalen Ordnung zusammenschließen könnten. Die USA können das Problem nicht so einfach lösen wie die Sabotage von Nord Stream 1 und 2.
Die Frage ist, ob diese Länder eine alternative neue Wirtschaftsordnung entwickeln können, um sich vor einem Schicksal zu schützen, wie es Europa in diesem Jahr für das nächste Jahrzehnt auferlegt wurde.
- https://www.jungewelt.de/artikel/435973.us-imperialismus-der-euro-ohne-deutsche-industrie.html